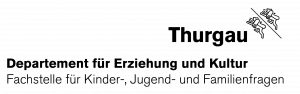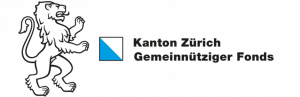Die Umsetzung der «Motion 19.3633 Ombudsstelle für Kinderrechte» ist nach wie vor Gegenstand politischer Diskussionen. Vor diesem Hintergrund hat die Ombudsstelle Kinderrechte Schweiz ein juristisches Gutachten in Auftrag gegeben, das die Verfassungkonformität und mögliche Optionen für eine öffentlich-rechtliche Verankerung untersucht. Das neue Gutachten von Prof. Dr. Felix Uhlmann von der Universität Zürich erläutert Varianten und vertieft die rechtlichen Grundlagen sowie Chancen und Risiken. Es kommt zum Schluss, dass eine öffentlich-rechtliche Ombudsstelle für Kinderrechte mit umfassenden Kompetenzen verfassungskonform ist. Die verschiedenen Umsetzungswege gilt es nun politisch sorgfältig abzuwägen.
Die «Motion 19.3633 Ombudsstelle für Kinderrechte» bildet den politischen Ausgangspunkt für die Schaffung einer Ombudsstelle für Kinderrechte in der Schweiz. Seit 2021 wird diese Aufgabe bekanntlich im Rahmen eines Modellvorhabens durch die Ombudsstelle Kinderrechte Schweiz wahrgenommen. Parallel dazu nahm 2023 die Schweizerische Menschenrechtsinstitution ihre Arbeit auf. Sie ist als öffentlich-rechtliche Institution des Bundes konzipiert, deren Auftrag darin besteht, den Schutz und die Förderung der Menschenrechte zu stärken.
Eine erste Vorlage des Bundes zur Umsetzung der Motion 19.3633 sah vor, dass mit einer Anpassung der Verordnung über die Förderung der ausserschulischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen (KJFV) die Grundlage dafür geschaffen wird, dass eine nationale Kinderrechtsorganisation Wissen teilt, Behörden beraten und die zahlreichen Akteure auf Bundes-, kantonaler und kommunaler Ebene vernetzen kann. Die Vorlage stiess in der Vernehmlassung jedoch auf Kritik – auch die Ombudsstelle Kinderrechte Schweiz zeigte sich unzufrieden mit der geplanten reduzierten Umsetzung (Link). Vor diesem Hintergrund beauftragte die Ombudsstelle Kinderrechte Schweiz Prof. Dr. Felix Uhlmann von der Universität Zürich mit einem Gutachten, um verfassungs- und rechtsgrundsätzliche Fragen zu klären, die derzeit politisch diskutiert werden.
Integration in das SMRI-Gesetz und eigenständiges Bundesgesetz als mögliche Ansätze
Eine erste Variante stellt die Integration der Aufgaben einer Ombudsstelle für Kinderechte in die bestehenden Strukturen der Schweizerische Menschenrechtsinstitution (SMRI) dar. Eine solche Variante wurde bereits früh vom zuständigen Bundesamt für Sozialversicherungen BSV als möglichen Ansatz aufgebracht und von Fachkreisen als adäquate Lösung anerkannt. Das Gutachten hält hierzu fest, dass die aktuelle Gesetzgebung der SMRI eine Ombudsfunktion zwar ausschliesst, aber eine Erweiterung des SMRI-Auftrags um diese Funktion grundsätzlich möglich ist. Dieser Ansatz mit der notwendigen Gesetzesanpassung könnte Synergien schaffen, da die Ombudsstelle von der bestehenden Struktur, den Netzwerken und der thematischen Nähe zur SMRI profitieren würde. Beide Institutionen verfolgen menschenrechtliche Ziele, sodass eine organisatorische Verbindung inhaltlich nahe liegt.
Gleichzeitig gibt die Analyse du bedenken, dass eine Integration in das SMRI-Gesetz bedeuten würde, dass die Ombudsstelle bei einer allfälligen Auflösung oder grundlegenden Reorganisation der Institution ebenfalls betroffen wäre. Hinzu kommen unterschiedliche Zuständigkeiten auf Verwaltungsebene – während die SMRI dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA zugeordnet ist, liegen die Kompetenzen einer Ombudsstelle für Kinderrechte beim Eidgenössischen Departement des Innern EDI. Auch das Ungleichgewicht im Gesetzesaufbau zwischen dem knappen SMRI-Gesetz und einem umfangreicheren Ombudsgesetz könnte zu rechtlichen und organisatorischen Spannungen führen. Zudem bestehe die Gefahr, dass die Ombudsstelle für Kinderrechte innerhalb einer grösseren Institution weniger sichtbar sei.
Als Alternative zu einer Integration in das SMRI-Gesetz nennt das Gutachten die Schaffung eines eigenständigen Bundesgesetzes über die Ombudsstelle für Kinderrechte Diese Variante würde die Unabhängigkeit stärken, eine direkte Anbindung an das EDI ermöglichen und die öffentliche Wahrnehmung der Ombudsstelle durch eine klare Positionierung und Sichtbarkeit sichern. Die Zusammenarbeit mit der SMRI und anderen relevanten Institutionen würde gemäss Gutachten vorzugsweise auf Verordnungsstufe oder über vertragliche Regelungen definiert werden, was die Flexibilität im Rahmen veränderter Bedürfnisse erhöhen würde.
Föderale Kompetenzordnung und ihre Auswirkungen auf eine Ombudsstelle
Unabhängig vom gewählten Modell zeigt das Gutachten, dass die Kompetenzordnung in der Schweiz bedeutet, dass je nach Rechtsgebiet unterschiedliche Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen bestehen, was die Ausgestaltung einer nationalen Ombudsstelle für Kinderrechte komplex macht.
So sei die Zulässigkeit einer Tätigkeit der Ombudsstelle gegenüber kantonalen Stellen danach zu differenzieren, ob es sich um eine vermittelnde oder eine beratende Funktion handelt. Eine vermittelnde Tätigkeit ist zulässig, wenn ein hinreichender sachlicher Zusammenhang mit einer bundesrechtlichen Kompetenz besteht – unabhängig davon, ob es sich formell um eine kantonale oder kommunale Behörde handelt. Eine beratende Tätigkeit kann darüber hinaus auch dann erfolgen, wenn keine Bundeskompetenz vorliegt, sofern sie informell, freiwillig und ohne rechtliche Verbindlichkeit im Rahmen der interinstitutionellen Zusammenarbeit stattfindet und keine hoheitlichen Funktionen übernommen werden. Während der Bund im Zivilrecht inkl. Internationales Privatrecht, Jugendstrafrecht, Opferhilferecht, Ausländer- und Asylrecht und Sozialversicherungsrecht über umfassende Gesetzgebungskompetenzen verfügt, liegen die Zuständigkeiten für das Bildungswesen, die Sozialhilfe und Teile des Gesundheitswesens primär bei den Kantonen.
Die Finanzierung ist eine weitere Knacknuss: Der Bund kann die Kantone nur eingeschränkt verpflichten, sodass in der Praxis eher auf freiwillige Leistungsvereinbarungen gesetzt werden müsste. Schliesslich unterliegt das Projekt der sogenannten Ausgabenbremse. Da die geschätzten jährlichen Kosten zwischen 2,5 und 3 Millionen Franken liegen, wäre im Parlament ein qualifiziertes Mehr erforderlich.
Gutachten als fundierte Grundlage für den weiteren politischen Entscheidungsprozess
Das Gutachten von Prof. Dr. Felix Uhlmann liefert eine sachliche Grundlage für die politische Diskussion zur geplanten Einführung einer öffentlich-rechtlichen Ombudsstelle für Kinderrechte. Es zeigt sowohl Chancen als auch Risiken einer Integration in das SMRI-Gesetz auf, beschreibt Alternativen mit einer eigenständigen Gesetzesgrundlage und legt die rechtlichen wie politischen Rahmenbedingungen offen. Welche Variante sich in welcher Form am besten eignet und letztlich durchsetzt, gilt es politisch sorgfältig auszudiskutieren.